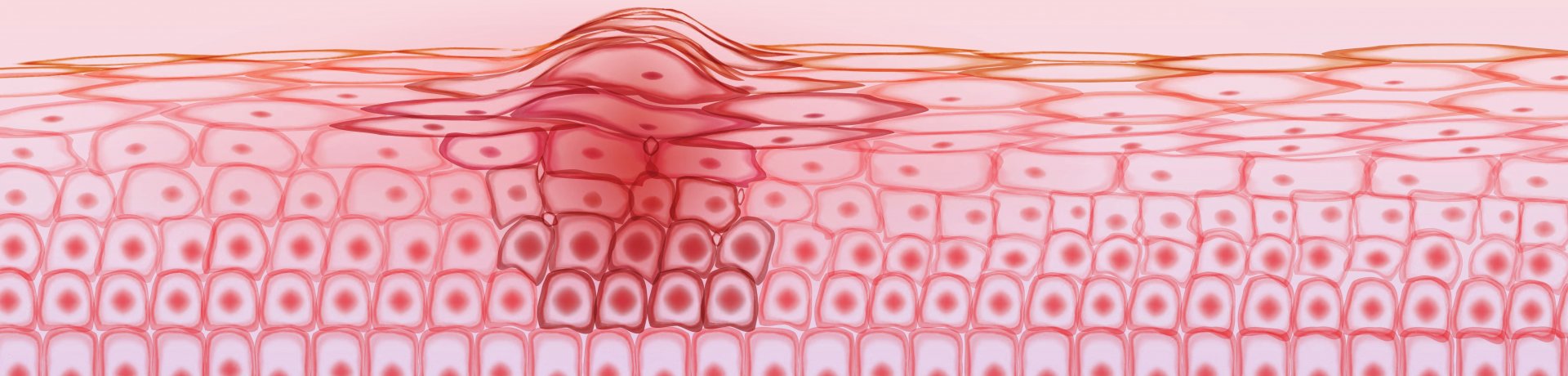
Behandlung des Schleimhautmelanoms
Zuletzt aktualisiert: 29.12.2024 | Autor(in): Prof. Dr. med. habil. Mirjana Ziemer
Die Therapie der ersten Wahl ist die Operation, also die möglichst vollständige chirurgische Entfernung des Tumors mit einem Sicherheitsabstand von in der Regel 1 cm.
Therapie der ersten Wahl bedeutet, dass diese Behandlungsform – hier die Entfernung durch eine Operation – zunächst die erste und wichtigste Behandlungsmaßnahme darstellt.
Die Operation sollte aber möglichst funktionserhaltend sein. PatientInnen kann die Wächterlymphknotenbiopsie angeboten werden. Dafür wird mittels spezieller Technik der Lymphabstrom vom Melanom in den nächstgelegenen Lymphknoten verfolgt, der dann entfernt und mikroskopisch auf Metastasen untersucht wird. Bei Lymphknotenbefall ist die Prognose schlechter. Je nach Tumordicke und Lymphknotenbefund wird mit Ultraschall der regionären Lymphknoten, Computertomographie (CT) und/oder Magnetresonanztomographie (MRT) des Körpers ggf. auch kombiniert mit der Positronenemissionstomographie (PET) eine mögliche Ausbreitung im Körper untersucht (= Ausbreitungsdiagnostik). Es sollten sowohl in die Diagnostik als auch nachfolgend in die Therapie und Nachsorge je nach betroffener Körperregion Fachdisziplinen wie z.B. der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Gynäkologie und Urologie hinzugezogen werden.
Die Bestrahlung hat für Melanome der Schleimhaut einen nachrangigen Wert. Bestrahlt wird vor allem dann, wenn aufgrund der Lokalisation oder Ausdehnung des Melanoms eine vollständige oder funktionserhaltende chirurgische Entfernung nicht möglich ist. Dann sind ebenso wie bei metastasierten Tumoren medikamentöse Tumortherapien medikamentöse Tumortherapien sinnvoll. Einige medikamentöse Therapien können an spezifischen Mutationen des Melanoms ansetzen. Dazu wird das Melanomgewebe mittels spezieller molekularer Untersuchungsmethoden auf Mutationen in bestimmten Genen – so insbesondere für c-KIT, BRAF und NRAS untersucht, weil für Melanome mit diesen Mutationen prinzipiell bereits medikamentöse Ansätze zur Verfügung stehen. Bei etwa 20% der Schleimhautmelanome werden spezielle c-Kit Mutationen nachgewiesen, bei 10-17% eine BRAF-Mutation und bei 5-10% eine NRAS-Mutation. Darüber hinaus finden sich beim Schleimhautmelanomen häufiger weitere Mutationen wie KRAS, NF1, PTEN und GNAQ. Umfangreiche Genexpressionsanalysen ermöglichen heute jedoch eine komplexe Analyse des gesamten Tumorgenoms, die über den Nachweis der erwähnten Mutationen weit hinausgeht. Die Ergebnisse solcher Genexpressionsanalysen werden in sogenannten „Molekularen Tumorboards“ – interdisziplinären multiprofessionellen Konferenzen – analysiert und interpretiert. Neben den behandelnden ÄrztInnen sind ExpertInnen der molekularen Diagnostik, Genetik, Bioinformatik und weitere Teil der Beratungsteams. Basierend auf der molekularen Charakteristik des Melanoms können dann individuelle Therapiekonzepte erarbeitet werden und zum Beispiel ein Einschluss in eine passende klinische Studie geplant oder auch ein Antrag auf Kostenübernahme für ein bestimmtes Medikament bei den Krankenkassen gestellt werden, welches möglicherwiese bereits für andere Tumore nicht aber für das Melanom zugelassen ist.
Innerliche Therapie
PatientInnen mit Schleimhautmelanom können innerlich behandelt werden. Bei der Therapie lehnt man sich vor allem an die Erfahrungen aus der Behandlung von Hautmelanomen an. Bei Vorliegen spezieller Tumorzellmutationen kann durch den Einsatz sogenannter zielgerichteter Therapien die Zellteilung der Tumorzellen verhindert werden. So kann bei einer BRAF-V600-Mutation eine Tablettentherapie mit einem BRAF-Inhibitor in Kombination mit einem MEK-Inhibitor erfolgen.. MEK-Inhibitoren sind prinzipiell auch eine Option bei NRAS-mutierten Melanomen ebenso wie bestimmte Proteinkinaseinhibitoren bei Vorliegen einer speziellen cKIT-Mutation, wobei für diese Medikamente keine speziellen Zulassungen für das Melanom vorliegen und deren Kostenübernahme somit bei den Krankenkassen beantragt werden muss. Unabhängig von einer Mutation steht allen Patienten die Immuntherapie in Form einer Infusionstherapie mit sogenannten Checkpointinhibitoren zur Verfügung. Diese stimuliert das körpereigene Immunsystem gegen die Tumorzellen. Hat eine Patientin oder ein Patient mit nachgewiesener BRAF-V600-Mutation prinzipiell beide Möglichkeiten der Therapie (also zielgerichtete Therapie oder Immuntherapie), ist es seitens der Behandler erforderlich, anhand aller Befunde (so zum Beispiel Anzahl, Größe und Lokalisation der Metastasen, sowie Allgemeinzustand) zu entscheiden, mit welcher Therapie begonnen werden soll. Darüber hinaus gibt es erste positive Daten für den Einsatz patienteneigener tumorinfiltrierender Lymphozyten (TIL), die aus dem Melanomgewebe gewonnen, im Labor vermehrt und nach einem speziellen Behandlungsprotokoll den Patienten zurückinfundiert werden. Neue Therapieoptionen verfolgen zum Teil auch kombinierte Behandlungsschemata zusammen mit Immuncheckpointinhibitoren und/oder anti-angiogenetischen (die Gefäßneubildung in Tumorgewebe bremsenden) Therapien.
Der Einsatz dieser medikamentösen Therapien erfolgt bei nicht-operablen oder metastasierten Schleimhautmelanomen aber inzwischen auch vorbeugend (adjuvant) nach vollständiger Entfernung eines fortgeschrittenen Melanoms. Neuere, bislang nur in Studien untersuchte therapeutische Ansätze beim Hautmelanom verfolgen inzwischen sogar den Therapiebeginn mit genannten Medikamenten, vor allem der Immuntherapie, bereits vor einer Operation (neo-adjuvant), was das Ansprechen verbessert. Vielversprechende erste Ergebnisse für den Einsatz von Immuncheckpointinhibitoren, zum Teil auch in Kombination mit weiteren Medikamenten, gibt auch bereits für das Schleimhautmelanom.
Link copied to clipboard!
Die Therapie der ersten Wahl ist die vollständige jedoch möglichst funktionserhaltende chirurgische Entfernung mit einem Sicherheitsabstand
Ab einer bestimmten Tumordicke erfolgen die Wächterlymphknotenbiopsie und eine entsprechende Apparatediagnostik zum Ausschluss von Metastasen.
Bei nicht vollständig operablen Melanomen oder Metastasen stehen innerliche Therapien zur Verfügung.
- REFERENZEN
- [1] Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Melanoms. Die S3-Leitlinie wurde überarbeitet und um das neue Kapitel „Adjuvante Therapie“ ergänzt.
INTERESSENSKONFLIKTE
Der Autor/die Autorin hat keine Interessenskonflikte angegeben.


