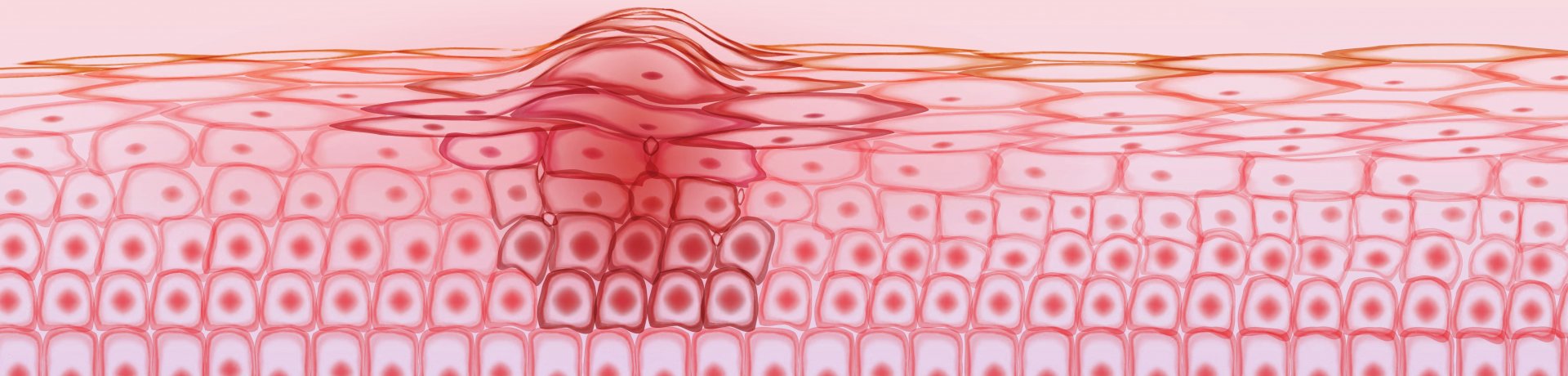
Welche Rolle spielen unsere Erwartungen beim Therapieerfolg?
Interview mit Prof. Ulrike Bingel, Leiterin des Zentrums für Schmerzmedizin am Universitätsklinikum Essen und Sprecherin des Sonderforschungsbereich „Treatment Expectation“ (Behandlungserwartung)
Die Neurologin Prof. Ulrike Bingel erklärt im Interview die Kraft von Placebo- und Noceboeffekten und ihre Bedeutung für PatientInnen.
Placebos sind eine Art Werkzeug, ein Wirkverstärker für Therapien. Und dazu braucht es keine Pille ohne Wirkstoff – eben ein Placebo, entscheidend ist der Effekt, der durch die Erwartung ein wirksames Medikament zu erhalten, ausgelöst wird. Die Erwartung bewirkt eine positive psychologische und körperliche Veränderung und aktiviert die innere, körpereigene Apotheke. Ebenso lösen Lernvorgänge Erwartungseffekte aus. Wenn die Erfahrung gelehrt hat, dass eine weiße runde Tablette die Kopfschmerzen lindert, wird das in gewissem Umfang unter bestimmten Bedingungen auch eine Zuckertablette tun. Die größten Effekte sind auf subjektive Symptome wie Schmerzen, Depression, schlechten Schlaf, Ängstlichkeit und Müdigkeit in vielen Studien belegt. Erwartungen sind aber nicht nur die treibende Kraft von Placeboeffekten, sondern sie modulieren eben auch die Wirksamkeit von echten Medikamenten. TherapeutInnen wie PatientInnen sollten die Kraft der Erwartung nutzen, um ihre medizinischen Behandlungen wirksamer und verträglicher zu machen. Aber ebenso wichtig ist es, negative Erwartungen zu vermeiden, um Noceboeffekte zu minimieren. Denn negative Erwartungen vermögen den Behandlungserfolg zu beeinträchtigen, oder können zum Auftreten von unerwünschten Wirkungen führen. In der medizinischen Praxis ist der Noceboeffekt vermutlich noch bedeutsamer ist als der Placeboeffekt.
Ist der Noceboeffekt bei KrebspatientInnen relevant?
Prof. Bingel: Noceboeffekte sehen wir besonders bei subjektiv empfundenen Symptomen und in stark angstbesetzten Situationen. Dies gilt für postoperative Schmerzen ebenso wie das Auftreten von Übelkeit oder das Erleben von neuropathischen Schmerzen, die als unerwünschte Folge eine Krebstherapie auftreten können. Gerade neuropathische Schmerzen sind – exemplarisch hervorgehoben – unberechenbarer als andere Schmerzen. Die Patienten sind häufig ängstlicher, erleben häufiger Schlafstörungen, depressive Episoden und Einschränkungen ihrer Lebensqualität. Viele dieser Bedingungen gelten auch bei Krebstherapien. Zunächst die Diagnose, die starke Unsicherheit und Ängste hervorruft, dann unterschiedliche Therapieansätze, die mit Schmerzen und unerwünschten Wirkungen assoziiert sind, eine langwierige Behandlungs- und Regenerationsphase, dann Kontrolluntersuchungen, die immer angstbesetzt bleiben.
Unsere Wahrnehmung von Behandlungen sowie deren Wirksamkeit werden durch unser Denken und unsere Gefühle geprägt. Negative Erwartungen, Ängste, Sorgen und Unsicherheiten können durch Noceboeffekte Symptome verstärken, neue Symptome (zum Beispiel Nebenwirkungen von Medikamenten) auslösen oder die Wirkung von Medikamenten (zum Beispiel einer lokalen Betäubung) abschwächen und so den gesamten Therapieeffekt und die Therapietreue negativ beeinflussen. Es können persönliche Erfahrungen, aber auch nur unreflektierte Annahmen dahinterstecken. Diese negativen Erwartungen entstehen durch Informationen, die PatientInnen von TherapeutInnen erhalten –und auch erhalten müssen –, aber auch durch Mitpatienten, durch Bekannte, durch die Medien. Wenn Sie bei Google „Chemotherapie und Nebenwirkung“ eingeben, erhalten Sie fast zwei Millionen Quellen. Nicht alle sind verständlich, hilfreich und objektiv belegt. Hier ist eine gute Kommunikation zwischen Arzt und Patient entscheidend, um Noceboeffekte zu minimieren. Ein weiterer Faktor ist: Auch persönlichkeitsbezogene Aspekte nehmen Einfluss. Eine Persönlichkeitsstruktur bei der Ängstlichkeit, Skepsis und eine negative Sichtweise dominieren, ist sicher empfänglicher für Noceboeffekte.
Was verstehen Sie unter guter Kommunikation?
Prof. Bingel: Es hilft vielen Menschen, wenn sie verstehen, was ein Wirkstoff in ihrem Körper auslöst. Jede Intervention, die ein Patient und eine Patientin nicht genau versteht oder die für ihn neu und unangenehm scheint, kann Ängste auslösen. Gerade komplexe Therapieansätze durch mehrere Fachärzte und unterschiedlichen Wirkmechanismen sind für die meisten nur schwer nachzuvollziehen und bergen deshalb ein besonders hohes Risiko, dass PatientInnen negative Erwartungen entwickeln. ÄrztInnen und medizinisches Personal sollten sich bewusst sein, dass die Kommunikation ein mächtiges therapeutisches Instrument ist – bereits beim ersten Kontakt in der Praxis oder Klinik. Daher bedürfen an Krebs Erkrankte sicher einer besonders intensiven kommunikativen Fürsorge und individuell auf Sie und ihre psychische wie physische Konstitution zugeschnittene Informationen.
Was ist ein Beispiel?
Prof. Bingel: Selbst ein unachtsam geäußerter Satz wie „Ohje, das sieht ja nicht gut aus!“ oder die mit Fachausdrücken gespickte Besprechung von Befunden und Behandlungsschritten (monoklonale Antikörper, BRAF-Mutation, präoperative Checkpoint-Blockade etc.) wirken eher einschüchternd. Das Risiko, dass zum Beispiel Schmerzen oder Übelkeit verstärkt empfunden werden und Schmerzmedikamente in ihrer Wirkung reduziert sind, ist hier gegeben. Und das gilt es als Erstes zu verhindern. PatientInnen kommen mit ganz unterschiedlichen Befindlichkeiten, Ansprüchen und Erwartungen. Man sollte deshalb auch immer fragen: „Was ist Ihre Sichtweise, was ist Ihre Erwartung?“ Es ist ganz entscheidend, welche Informationen PatientInnen sich von ihren ÄrztInnen über ihre Erkrankung und die Behandlung wünschen, und dass Vorerfahrungen und Vorinformationen, insbesondere, wenn sie negativ sind, berücksichtigt werden.
Wo ist der Einfluss von Erwartungen und Erlerntem besonders groß?
Prof. Bingel: Wir wissen, dass die Lerneffekte von aversiven Ereignissen besonders stark sind. Wenn man einmal erfahren hat, dass eine Chemotherapie Übelkeit hervorrufen kann, dann kann schon das Betreten des Therapieraumes Unwohlsein auslösen. Das sind eindeutig Triggerfaktoren. Angespannte Aufmerksamkeit und Angst zusammen mit der Erwartung und Lernerfahrung können dazu führen, dass tatsächlich früher eine Nebenwirkung empfunden wird als durch den eigentlichen pharmakologischen Vorgang zu erwarten ist. Ebenso spielt der Behandlungskontext eine Rolle: Wie sieht es in der Praxis aus? Wie werde ich begrüßt? Wie riecht es? Was höre ich? Wieviel spüre ich von der Behandlung?
Welche Rolle spielt die Beziehung von Patient und Behandler hierbei?
Prof. Bingel: Sie ist extrem wichtig. Vertrauen ist die essenzielle Basis. Und Vertrauen, das wissen wir, entsteht über viele Faktoren in einem gewissen Zeitrahmen, selten innerhalb von wenigen Minuten. Deshalb plädiere ich für ein engmaschiges Kontakthalten und „Kümmern“, etwa nach einer invasiven Therapie. Ein Anruf aus der Praxis „Wie geht es ihnen heute einen Tag nach dem Eingriff? Haben Sie noch Fragen?“, ist für jeden Patienten eine vertrauensfördernde Maßnahme.
TherapeutInnen sollten wichtige und positive Informationen zu Beginn und am Ende des Gesprächs geben, da die Informationen dann besser behalten werden. Hilfreich ist es Framingeffekte zu nutzen: Die Formulierung „Zehn Prozent der Patienten haben Nebenwirkungen“ führt zu mehr Nebenwirkungen als die Formulierung „90 Prozent der PatientInnen vertragen das Medikament sehr gut“. Es geht keineswegs darum, Informationen zu unterschlagen oder zu beschönigen, sondern sie so zu vermitteln, dass PatientInnen sie angstfreier aufnehmen. Ich bin überzeugt, dass es gut ist, die Eigenverantwortung der PatientInnen und ihren aktiven Beitrag zu stärken. Sie sollten im Therapieprozess möglichst engmaschig mitarbeiten dürfen, natürlich nur, wenn sie das wollen. Das fördert die Selbstwirksamkeitserwartungen. Ein Gesprächsangebot, in welcher Lage auch immer, ist deshalb extrem wichtig. Aber auch Betroffene können hier eine Menge tun. Stellen Sie Fragen, wann immer sie etwas nicht verstehen! Bereiten Sie sich auf den Arztbesuch vor und notieren sie ruhig die Fragen! Oft geht es hektisch zu, es ist nicht viel Zeit und da ist eine Notiz oder auch die Begleitung durch ein zweites paar Ohren hilfreich.
Was empfehlen Sie?
Prof. Bingel: Im Internet sind häufig emotional aufwühlende Berichte zu finden. Das erzeugt – absolut nachvollziehbar – Aufregung, Ängste und Sorgen. Eben daher ist eine empathische und offene Haltung, die auch ein Gespräch in der Praxis oder Klinik über Sorgen erlaubt, von so großer Bedeutung im Kontakt mit Patienten. Das gilt sowohl für die PatientInnen- als auch TherapeutInnenseite. Als Patient und Patientin sollten Sie nach guten informativen Internetseiten zu dem speziellen Fachgebiet fragen, wie es hier das Infoportal Hautkrebs ist, und vielleicht sehen Sie sich auch unseren PatientInnenbereich unter www.treatment-expectation.de an. Unter „Entdecken und Mitmachen“ geht es speziell um ihre eigenen Erwartungen – von der Vorbereitung auf den Arztbesuch, das erste Gespräch und um Fragen z. B. zu unerwünschten Wirkungen, die im Beipackzettel ihres Medikaments aufgeführt sind. Dies sind wichtige Anregungen für die Arzt-Patienten-Kommunikation. Für die allermeisten Patientinnen und Patienten ist aber vor allem der Austausch mit anderen Betroffenen extrem hilfreich!
Link copied to clipboard!

Prof. Ulrike Bingel, Leiterin des Zentrums für Schmerzmedizin am Universitätsklinikum Essen
Foto: Martin Kaiser (UDE)


